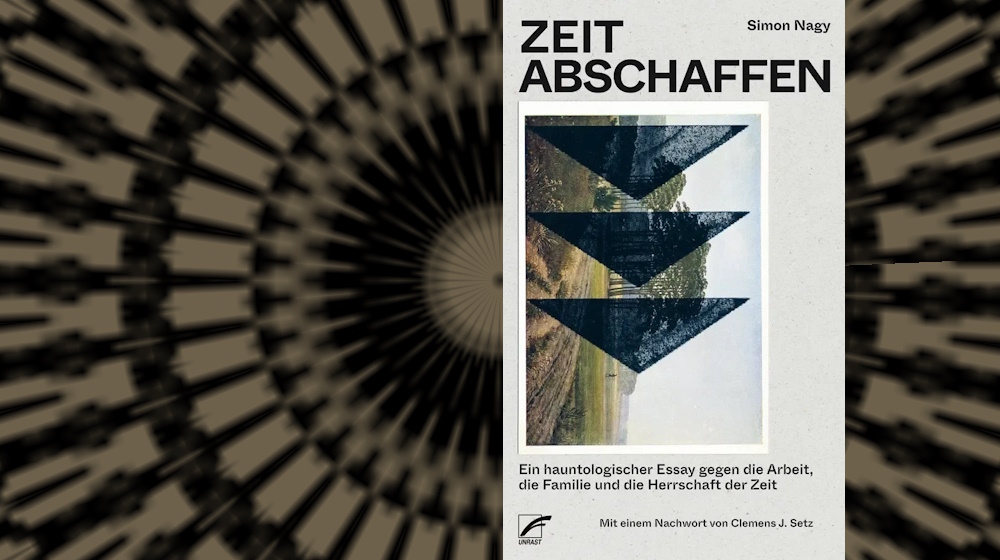Simon Nagy Zeit abschaffen. Ein hauntologoscher Essay gegen die Arbeit, die Familie und die Herrschaft der Zeit Mit einem Nachwort von Clemens J. Setz, Unrast Verlag, Münster 2024, 188 Seiten, 14 Euro, ISBN 978-3-89771-622-3
Das ständige Gefühl, keine Zeit zu haben, ist keine Schwäche des persönlichen Managements. Die Zeit ist nicht einfach da, sie wurde standardisiert, wird eingeteilt und mit Imperativen versehen, die uns dank Warenlogik in Fleisch und Blut übergegangen sind.
Simon Nagy beginnt seinen Essay mit dem Versuch des Anarchisten Martial Bourdin, die Zeit in die Luft zu jagen. Der Sozialrevolutionär wollte 1894 die Uhr in Greenwich sprengen, die die international genormte Zeit repräsentierte. Er scheiterte und brachte sich mit seiner Bombe versehentlich selber um. Anarchist*innen waren gegen jede Herrschaft, auch gegen die über die und durch die Zeit.
Kulturelle Einrichtung und Konterrevolution
Die Zeit ist eine kulturelle Einrichtung, die Vergangenheit und Zukunft miteinander in Beziehung setzt. In ihr lässt sich die Gegenwart als Ergebnis von Kämpfen ausweisen, nichts musste so kommen, wie es ist. Nicht eingetretene Ereignisse und begonnene Kämpfe können fortwirken, tauchen wie Gespenster in der Gegenwart auf. Gespenster überwinden die Grenzen des Zeitlichen, sie sind Botenträger*innen, die das Nicht Mehr in ein Noch Nicht transportieren können. Von solchen Gespenstern handelt das Buch „Zeit abschaffen“.
Eine Vorstellung von Veränderbarkeit wird dabei vermittelt, die der Neoliberalismus zunichte machen möchte, weil sie seiner Strategie der Anhäufung und Konzentration von Reichtum hinderlich ist. Nagy nennt ihn eine Konterrevolution, die auf das Aufbegehren um 1968 regiert hat. Wie der Kapitalismus überhaupt, arbeitet der Neoliberalismus daran, den Glauben aufrecht zu erhalten, „dass die aktuellen Arbeits-, Produktions- und Lebensweisen die objektiv notwendigen und sogar rationalen sind“ (111). Die Logik des Sachzwangs. Der Neoliberalismus spitzt eine dem Kapitalismus innewohnende Tendenz zu: Die Zeit auf verwertbare Arbeitszeit zu reduzieren, alle nicht verwertbaren Zeitnutzungen abzuwerten und schließlich zu unterbinden. Oder zu integrieren, und vormals deviante (1) Haltungen wie kreative, flexible Lebens- und Arbeitsgestaltungen wertsteigernd einzusetzen.
Alle Arbeit abschaffen
In Wirklichkeit aber gibt es angesichts der technologischen Entwicklung keinen Grund mehr, das menschliche Leben „um wertgenerierende Arbeit herum zu strukturieren“ (120). Trotzdem aber kommt die Revolution nicht. Es gelte also, so Nagy, die „Abschaffung der Arbeit“ als uneingelöstes Versprechen der Gespenster, als Forderung und Ziel wieder aufzugreifen. Und zwar nicht nur Industriearbeit, sondern auch die Reproduktionsarbeit, das Kümmern und Pflegen, die mental load, wie es heute heißt.
Die Sprengung der Zeit scheitert wohl nicht in erster Linie am Umgang mit Dynamit.
Wie das in einer arbeitsteiligen Gesellschaft zu bewerkstelligen ist, ist aus der Negation (Abschaffen) nicht einfach abzuleiten. Es erfordert vielleicht eine eingehendere Rezeption von kollektiv organisiertem Fabrikbetrieb während der Spanischen Revolution 1936, von bohemistischem Feiern, der Eroberung des Alltags durch den Ausbruch von Frauen aus kleinfamiliären und patriarchalen Strukturen, der Sabotage der Arbeit durch operaistische Arbeiter-Aktivist*innen u.v.a., die Nagy alle nur streift. Das ließe sich kritisieren. Aber Nagy watet mit so vielen nachvollziehbaren Beispielen aus Filmen, Romanen und Pop-Songs auf, dass ihm dieser Mangel nachgesehen werden kann. Statt im Park Joggen zu gehen, ließe sich ja auch theoretisch wie praktisch an die nicht angehobenen Kämpfe anknüpfen.
Gespenster vergangener Kämpfe
Trotz und gerade wegen der neoliberalen Indienstnahme des Begehrens, nach „me time“ beim Joggen oder Kunstmachen beispielsweise, lohnt sich der Blick auf die Gespenster, die eine Alternative anboten und vernichtet wurden, „bevor sie überhaupt anheben konnten“ (162). An vergangene Kämpfe zu erinnern, deren Spuk in der Gegenwart wirkmächtig werden könnte, ist das erklärte Ziel des Buches. Die von Mark Fisher reformulierte Einsicht, dass nichts im Sozialen naturgegeben und alles historisch entstanden ist, tritt als motivierende Ausgangsthese zutage. Auch die Gespenster und die Zeitdiagnose greift Nagy vom 2017 verstorbenen Kulturtheoretiker Fisher auf, der mit seinem Buch „Kapitalistischer Realismus“ (2009, Dt. 2013) einige Diskussionen in der Linken über die Ausweg- und Alternativlosigkeit im Gegenwartskapitalismus losgetreten hatte.
Die Lesezeit kann man sich gut einteilen, alle drei bis fünf Seiten kommt ein neuer, mit einem Zitat eingeleiteter Teil. Was Nagy da aus popkulturellen Werken herausholt, sind erstaunliche Belege und Bebilderungen gespenstischer Wiederkehr. Er steht damit durchaus im Kontext des Spuks, den Theoretikerinnen wie Bini Adamczak („gestern morgen“, 2011) und Luise Meier („MRX Maschine“, 2018) in den letzten Jahren in ihren Schriften aktualisiert haben. Aus anarchistischer Sicht gegen die Arbeit angeschrieben hatte auch schon der US-amerikanische Occupy Wall Street-Aktivist und Anthropologe David Graeber („Bullshit Jobs“, 2018). Die Sprengung der Zeit scheitert wohl nicht in erster Linie am Umgang mit Dynamit. Um angesichts dessen nicht, wie Fisher, an Depressionen zugrunde zu gehen, können Texte wie jener Nagys sicherlich einen Beitrag leisten.
(1) Als Devianz (von lateinisch deviare, deutsch vom Weg abweichen) oder abweichendes Verhalten (früher auch Verirrung) werden u.a. in der Soziologie Verhaltensweisen bezeichnet, die mit geltenden Normen und Werten nicht übereinstimmen.
Dies ist ein Beitrag aus der aktuellen Ausgabe der Graswurzelrevolution. Schnupperabos zum Kennenlernen gibt es hier.