Lea Susemichel und Jens Kastner: Identitätspolitiken. Konzepte & Kritiken in Geschichte & Gegenwart der Linken. Unrast-Verlag, Münster 2018. 150 Seiten, 12,80 Euro, ISBN 978-3-89771-320-8
Die Debatte um eine „neue Klassenpolitik“ innerhalb der deutschsprachigen Linken wurde einerseits durch die Erfolge des sogenannten „Rechtspopulismus“ von Trump bis AfD und andererseits durch Didier Eribons „Rückkehr nach Reims“ entfacht. Sie hat eine „identitätspolitische“ Abwehrreaktion ausgelöst. Exemplarisch lässt sich diese sicherlich aus dem Beitrag „Rückkehr des Hauptwiderspruchs?“ von Emma Dowling, Silke van Dyk und Stefanie Graefe (Prokla 188/2017) herauslesen, obwohl dieser Beitrag die Mankos einer tendenziell klassenvergessenen Identitätspolitik durchaus benennt.
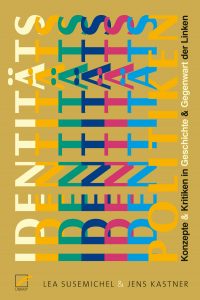 Zu einem kleinen „Shitstorm“ von differenzfeministischer Seite kam es, als der Blog re:volt magazine den Beitrag „Die Vergessenen. Industriearbeiterinnen und Feministinnen – zwei Welten ohne Verbindung“ (abgedruckt in dem Sammelband „Neue Klassenpolitik“) in den virtuellen Netzwerken veröffentlichte: Die Gewerkschaftssekretärin Katja Barthold hatte die Abgeschlossenheit der (queer)feministischen Szene gegenüber aktiven Arbeiterinnen kritisiert. Die Kritik, die sie daraufhin über sich ergehen lassen musste, resultiert aus der reichlich überkommenen Annahme, es gäbe ein politisches Subjekt „Frau“, dass über Klassengrenzen hinweg zusammen kämpfen müsse. Die globale Frauen*streikbewegung hat seit 2016 diese Form der Identitätspolitik überwunden, indem sie den „progressiven Neoliberalismus“ (Nancy Fraser) deutlich von einem „antikapitalistischen Feminismus“ differenziert (siehe dazu den Schwerpunkt dieser GWR 437 und den Sammelband 8M – Der große feministische Streik). Eine bitter notwendige Distanzierung, die bislang in Deutschland leider noch kaum Tradition hat.
Zu einem kleinen „Shitstorm“ von differenzfeministischer Seite kam es, als der Blog re:volt magazine den Beitrag „Die Vergessenen. Industriearbeiterinnen und Feministinnen – zwei Welten ohne Verbindung“ (abgedruckt in dem Sammelband „Neue Klassenpolitik“) in den virtuellen Netzwerken veröffentlichte: Die Gewerkschaftssekretärin Katja Barthold hatte die Abgeschlossenheit der (queer)feministischen Szene gegenüber aktiven Arbeiterinnen kritisiert. Die Kritik, die sie daraufhin über sich ergehen lassen musste, resultiert aus der reichlich überkommenen Annahme, es gäbe ein politisches Subjekt „Frau“, dass über Klassengrenzen hinweg zusammen kämpfen müsse. Die globale Frauen*streikbewegung hat seit 2016 diese Form der Identitätspolitik überwunden, indem sie den „progressiven Neoliberalismus“ (Nancy Fraser) deutlich von einem „antikapitalistischen Feminismus“ differenziert (siehe dazu den Schwerpunkt dieser GWR 437 und den Sammelband 8M – Der große feministische Streik). Eine bitter notwendige Distanzierung, die bislang in Deutschland leider noch kaum Tradition hat.
In den Kontext der Verteidigung möchte man zuerst einmal auch die Einführung in „Identitätspolitiken“ von Lea Susemichel und Jens Kastner einordnen, zumal sie dezidiert die Kritik Nancy Frasers zurückweisen (S.22f.). Gegen Frasers These, dass für Trumps Erfolg eine „anti-neoliberale Haltung wahlentscheidend gewesen sei“, vermuten sie „Rassismus, Sexismus und Homofeindlichkeit“ als Wahlmotive. Ins Abseits geraten dabei leider jegliche Spekulationen darüber, wie diese Einstellungen entstehen. Arlie Russell Hochschild hat in ihrem Buch „Fremd in ihrem Land: Eine Reise ins Herz der amerikanischen Rechten“ eine massenpsychologische Erklärung ins Spiel gebracht, eine „Tiefengeschichte“, die Klaus Dörre auch für eine Analyse des Wähler*innenpotentials der AfD nutzbar gemacht hat. Das zum einen, zum anderen halten Susemichel und Kastner Fraser entgegen, dass die „tonangebenden Strömungen der neuen sozialen Bewegungen“ keineswegs ein Bündnis mit dem neoliberalen Establishment eingegangen wären.
Auch hier muss man tiefer graben: Natürlich ist dies kein geplantes und gewolltes Zweckbündnis, nichtsdestotrotz besteht die Linke – einschließlich der radikalen – nun mal mittlerweile zu einem großen Teil aus Akademiker*innen, die es sich, auch bei antikapitalistischer Gesinnung, im progressiven Neoliberalismus relativ gemütlich machen können. Idealtypisch finden wir das bei den Grünen, der vermutlich klassenvergessensten Partei Deutschlands, die auch deshalb favorisiertes Hassobjekt der AfD-Wählerschaft ist.
Die konträre Gegenüberstellung von „Identitätspolitik“ und (neuer) „Klassenpolitk“ ist dennoch eine grundfalsche. Das zeigen Susemichel und Kastner überzeugend in ihrer Darstellung von Identitätspolitiken des Klassenkampfes (S.21 – 28) und der Arbeiter*innenbewegung (S.39 – 53). Etwas pauschalisiert ließe sich behaupten, während die „Klasse an sich“ eine Positionsbestimmung enthält, war die Politik mit einer „Klasse für sich“ klassische Identitätspolitik. Lenin steht dafür paradigmatisch. Auch die Einführung der „Klassismus“-Theorie muss als (kulturelle) Übertragung der modernen (feministischen) Identitätspolitik auf die Diskriminierungs-Aspekte der Klassengesellschaft heute verstanden werden. Die Politikwissenschaftlerin Jodie Dean etwa beschrieb gegenüber dem Rezensionsportal „kritisch lesen“ im Interview: „Klasse ist keine Identität, sondern eine Position. Und als eine Position kann Klasse von allen möglichen Identitäten besetzt werden.
Klasse durchschneidet diese ‚identitären Logiken‘“. Wer also Klassenpolitik und Identitätspolitik in eins setzt, vergleicht letztlich Äpfel und Birnen, das gilt auch für die „triple (oder multiple) oppression“-Theorien, da sie „oppression“ in den Mittelpunkt stellen und daher erstens Ausbeutung und Diskriminierung nicht analytisch trennen und zweitens kaum vom Handeln der Subjekte, sondern vom Behandeln derselben ausgehen. Darüber hinaus ist der eingangs genannte Abwehrreflex aber schon deswegen unverständlich, weil das „Neue“ an der Debatte um die „Neue Klassenpolitik“ ja gerade die Integration der verschiedenen identitätspolitischen Themen ist (in dem entsprechenden Sammelband siehe zum Beispiel die Beiträge von Nelli Tügel, Ceren Türkmen oder Martin Birkner).
Offenbar wird hier manchmal die Debatte um die Klassenpolitik in eins gesetzt mit der Wagenknechtschen Position der („populistischen“) Anbiederung an rechtes Gedankengut bei den Wähler*innenmassen. Das hat aber nichts zu tun mit einer neuen Klassenpolitik, wie sie auch in der Partei Die Linke (siehe das gleichnamige Buch von Bernd Riexinger) zunehmend formuliert wird. Gegenüber den politischen Vorstellungen des Lafontaine/Wagenknecht-Flügels, den es so durchaus auch in den sozialen Bewegungen gibt, ist die kritische Einführung in die Identitätspolitiken eine bitter notwendige Klarstellung.
Was dann aus klassenlinker Perspektive an den Identitätspolitiken kritisiert wird, ist weniger eine Berufung auf eine geschlechtlich oder migrantisch geprägte Identität, sondern die Form dieser Politik. Deutlich und ausführlich machen Susemichel und Kastner das am Beispiel der sogenannten „kulturellen Aneignung“ (S.76 – 91). Leider nur angerissen werden weitere Aspekte dieser Kritik wie „Trigger-Warnungen“, „Privilegien verlernen“ oder „Microaggressions“ (S.131). Deutlich wird dennoch, dass die Autor*innen diese Kritik und vor allem das poststrukturalistische Unbehagen an Identitätskategorien teilen, wobei sie die Form heutiger Identitätspolitiken eher als Symptome denn als grundsätzlich angelegtes Strukturproblem derselben verstehen. Seltsamerweise ist die Wendung der (radikalen) Linken zu einer Identitätspolitik einhergegangen mit dem akademischen Hoch des Poststrukturalismus. Das ist deswegen befremdlich, weil die poststrukturalistischen Theorien – allen voran Judith Butler – eigentlich zu einer Kritik der Identitätskategorie angetreten waren (S.120 – 126).
Gerade diese Debatten führten, anders als intendiert, zu einem „Identitätsfetisch“, an dem der Poststrukturalismus mit seiner Betonung der „spezifischen Kämpfe“ (Foucault) und „Mikropolitiken“ vielleicht nicht ganz unschuldig ist: Das Augenmerk auf Differenz führt „paradoxerweise auch dazu, dass die Gruppe, der man sich zugehörig fühlt, nun immer spezifischer definiert und von anderen abgegrenzt wird“ (S.125). Daher ist auch die akademische Version der „multiple oppression“, die „Intersektionalität“ letztlich zu problematisieren: „Meiner Meinung nach“, so Jodie Dean im zitierten Interview, „führt eine intersektionale Analyse […] fast immer dazu, den Schnittpunkt, die ‚intersection‘, im Individuum zu suchen“.
Diese Berufung auf eine immer engere Identität, die bei dem Individuum landet – eben dem vorrangigen Subjekt auch des Neoliberalismus – birgt wahrscheinlich einen Kern des Konflikts. Der andere, der die Klassenpolitik ebenso tangiert wie die aktuellen Formen des Feminismus, ist die Frage eines „materialist turn“. Letzterer ist es, der hinter der Befürchtung eines neuen „Hauptwiderspruchsdenken“ steckt. Dabei war und ist ein materialistischer Feminismus jenseits eines solchen Denkens aktuell eine neue Hoffnung – das geht übrigens durchaus auch im Bezug auf poststrukturalistische Denkweisen.
Torsten Bewernitz